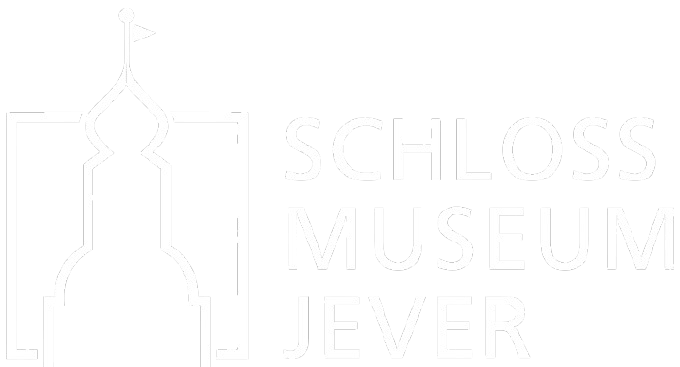Zu den herausragenden Zeugnissen der jeverschen Landesgeschichte gehört das sog. Fadenglas. Es ist bereits in den ältesten Inventaren des Schlosses aus dem 16. und 17. Jahrhundert verzeichnet.

Farbloses Glas mit weißen Fadeneinlagen, Fuß, Silber
Antwerpen (?), um 1570
Leihgabe: Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte Oldenburg
Auch im 19. Jahrhundert wird die Kostbarkeit zusammen mit anderen Zimelien in einem Mahagonischrank im Wohnzimmer der Großherzogin präsentiert:
„Im Wohnzimmer der Frau Großherzogin2, 1850
1 mahagonie Nipschrank, worin befindlich:
2 eiserne Ärmel vom Panzer (Das Kettenhemd Marias)
1 silber vergoldeter Pokal nebst Deckel (Der Huldigungsbecher)
1 silberner Altarkelch mit zwei Hostienteller
1 metallenes Blashorn (Das Signalhorn von der Sibetsburg)
1 gläserner Humpen mit 2 Wappen
1 gläsern weiß gestreifte mit Deckel und silbernen Fuß (Das Fadenglas)
12 Pocale von Glas mit dito Deckeln“.
Die Landesherrin Maria (1500-1575) soll aus diesem Glas ihrem Nachfolger Graf Johann VII. von Oldenburg „zugetrunken“ haben; ein festlicher Akt, der die Übertragung des Jeverlandes an die Grafschaft Oldenburg 1573/1575 unterstreichen sollte. Das Zutrinken war sicherlich der krönende Abschluss der Feierlichkeiten aus Anlass der Eventualhuldigung am 20. Oktober 1574. Nach einer schweren Krankheit ließ Maria Johann VII nach Jever kommen, wo ihm von ihrem Hofstaat und den Vertretern von Stadt und Land gehuldigt wurde.3
Das kostbare und luxuriöse Glas ist vermutlich Antwerpener Arbeit und in der in Venedig gepflegten Technik mit unterschiedlichen Farbabstufungen gestaltet. Die besondere Wertschätzung unterstreicht auch, dass es 1690 durch den jeverschen Goldschmied Rudolf Onnen mit einer vergoldeten Silberfassung im Auftrag der regierenden Fürsten von Anhalt-Zerbst versehen wurde.
Da es sich um einen zentralen Gegenstand für die Identität und Geschichte des Jeverlandes handelt, wurde das Fadenglas bis 1921 im Schloss zu Jever präsentiert. Am 28. April 1921 hatte sich der damalige Direktor des Landesmuseums Walter Müller-Wulckow (1886-1964) das Fadenglas und auch den Huldigungsbecher aus dem Jahre 1542 von Schlossverwalter Johann Broockmann aushändigen und in einer Kiste nach Oldenburg bringen lassen. Der für das Museum zuständige Vorstand des Jeverländischen Altertums- und Heimatverein war nicht in diese Transaktion einbezogen worden und reagierte mit einem empörten „Das lassen wir uns nicht gefallen“, wie im Protokollbuch des Vereins vermerkt. Auch der Historiker und Leiter des Oldenburgischen Archivs Georg Sello nahm in seiner noch immer lesenswerten Landesgeschichte „Östringen und Rüstringen“ auf Seiten der Jeverländer Stellung: „Graf Anton Günther, die Anhaltiner, die Russen, Holländer und Franzosen, ja auch der Sammeleifer von Altens in großherzoglich-oldenburgischer Zeit hatten die Reliquien einer schon zum Teil der Sage anheimgefallenen rühmlichen Vergangenheit respektiert, bis die neue Ära von 1918 die geschichtlichen Zusammenhänge gewaltsam zerrissen und beide Stücke in dem staatlichen Museum in der Stadt Oldenburg kasernierte … Gewiß kommt es vor allem darauf an, dass „die Zeugen der Vergangenheit in uns weiterleben“, aber darüber hinaus kommt es darauf an, dass die Zeugen an der rechten Stelle stehen und zu uns sprechen können; das heißt nicht in dem wesensfremden Staatsmuseum in Oldenburg, sondern in dem tatsächlich allein die Tradition weiterführen Heimatmuseum zu Jever. Musealer Schildbürgerstreich erscheint es demgegenüber, dass, um den historischen Ansprüchen entgegenzukommen, der Aufbewahrungsort halbjährlich wechselnd bald in Jever bald in Oldenburg sein soll.“4
Nachfolgend entspannte sich ein langwieriger Streit um den Verbleib des kostbaren Glases, der noch nicht abgeschlossen ist. Nach jahrelangem halbjährlichem Wechsel des Fadenglases und des Huldigungsbechers zwischen Jever und Oldenburg kam man schließlich zu dem Kompromiss, dass der Huldigungsbecher in Jever und das Fadenglas in Oldenburg verbleiben sollte.5 Dennoch ist der Vorgang natürlich immer noch nicht vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung für die jeverländische Geschichte endgültig geklärt. Dies gilt auch für weitere Objekte, die im Zuge der Zentralisierung und Bildung einer „oldenburgischen Geschichte“ aus dem Schloss zu Jever ins Landesmuseum gekommen sind. Hier sollen und müssen sicherlich noch weitere Verhandlungen folgen.
Ab September 2025 ist das Fadenglas jedoch im Schlossmuseum Jever aus Anlass des 450. Todestages und 525. Geburtstages Marias von Jever zu besichtigten.
von Antje Sander, die sich natürlich schon einmal sehr freut, dass das Fadenglas zumindest am 525. Geburtstag des Fräuleins wieder im Schloss zu Jever zu sehen ist …1 Zitiert: Georg Sello, Östringen und Rüstringen, Oldenburg 1928, S. 245.
2 Niedersächsisches Landesarchiv, Abteilung Oldenburg (NLA Ol), Best. 10, Best.12-1 Nr. 23 Meubln-Inventarium des Grossherzogl. Schlosses zu Jever, Inventarium des Schlosses zu Jever aufgenommen am 27. August 1850. Die genannten Zimmer wurden wohl von der zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Großherzogin Cäcilie (1807-1844) genutzt.
3 NLA OL Best. 90 Tit.5, Nr. 1, betr. die Grafen Johann von Oldenburg im Jahre 1574 in Jever geleistete Eventualhuldigung , 1574, April 20 – Dez. 23 (alte Sig. Aa Herrschaft Jever, Abt. A, Tit. V no. 82).
4 Georg Sello, Östringen und Rüstringen, Oldenburg 1928, S. 245.
5 Über diesen Streit gibt es einen umfangreichen Aktenbestand sowohl im Archiv des Schlossmuseums Jever als auch im Landesarchiv Oldenbrug. NLA OL Best. 262-4, Nr. 11690, 1923-1951.