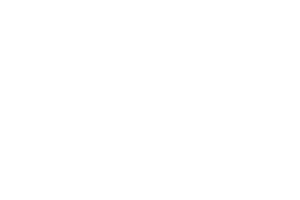Reizvoller Landschaftsgarten mit vielen Schätzen an Flora und Fauna
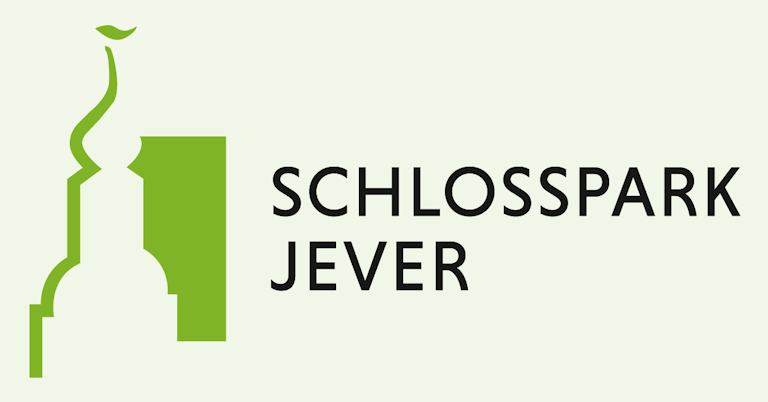
Kontakt
Andreas Folkers, Dipl.-Geogr.
Projektleitung Schlosspark Jever im Klimawandel
Schlossmuseum Jever
Schlossplatz 1 – 26441 Jever
E-Mail: a.folkers@schlossmuseum.de, schlosspark@schlossmuseum.de