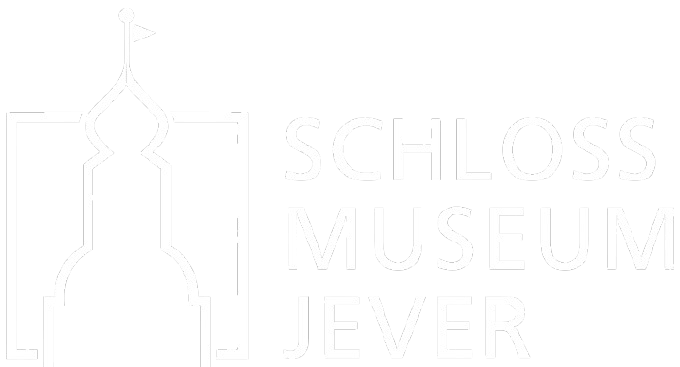Das Porträt ist weit mehr als nur die Darstellung eines Gesichts – es ist auch ein Fenster in eine Epoche: die Mode, die sozialen Strukturen einer Gesellschaft, die Themen der Zeit. Das Schlossmuseum Jever besitzt eine Reihe Porträts von Personen, die mit dem Landstrich verbunden sind und zudem oft von lokalen Künstlern gemalt wurden. Vier von ihnen stellen wir hier im Zusammenhang mit ihrer Epoche vor.
Stand und Macht
Wer ließ sich malen? Wer konnte sich ein Porträt leisten? Bis vor 200 Jahren waren das in der Regel die Regenten eines Landes und der Adel. Ihr Porträt kam mit einem Machtanspruch; wo es hing, signalisierte es den Betrachtenden, wer dort regierte. Deshalb die Insignien wie Zepter und Krone, die prunkvollen Gewänder. Der Gesichtsausdruck konnte Tugenden wie Milde und Güte ausdrücken. Viele Maler vollbrachten ein Kunststück schon allein dadurch, dass sie den Auftrag, ein würdiges, ansehnliches Antlitz zu präsentieren, mit der Darstellung nicht immer hübscher Gesichter verbanden. Wirklichkeitstreue in unserem heutigen Sinne war nicht das erste Gebot; wiedererkennbar mussten die Personen aber dennoch sein.
Nach Jever wurde ein Porträt der Zarin Katharina geschickt, weil sie das kleine Jeverland 1762 geerbt hatte. Sie hat diesen Landstrich zu ihren Regierungszeiten nie betreten (nur ein, zwei Mal als Kind) und ließ sich durch ihre Schwägerin Friederike Auguste Sophie von Anhalt-Zerbst als ihrer Statthalterin vertreten. Aber im Porträt war sie präsent.

Mit der Epoche der Aufklärung rückt zunehmend der einzelne Mensch und seine Individualität in den Fokus. Gefühle, persönliche Eigenheiten, individuelle Charakterzüge dürfen oder sollen sogar sichtbar werden. Während der Industrialisierung gewinnen andere Kreise der Gesellschaft an Einfluss und Bedeutung. Porträts zeigen nicht mehr nur Herrscher, sondern auch Bürgerliche, Gelehrte oder Künstler. Die Fotografie wird erfunden und macht dem gemalten Porträt Konkurrenz.
Individualität statt Herrschaftspose
Ernst Hemken (1834-1911) wurde in Jever geboren, lebte aber die meisten Jahre seines Lebens in anderen Regionen Europas. Er hielt sich in Italien und London auf, vor allem aber viele Jahre in Weimar und Dresden, wo er ausgebildet wurde und sich einen Namen als ausgezeichneter Maler und Kopist erwarb.
Noch bedroht die neu erfundene Daguerreotypie – als ein Vorläufer der Fotografie – das Porträtfach nicht: Das wohlhabende Bürgertum nutzt Gemälde nach wie vor zur Repräsentation. Der Stil und Aufbau der Darstellungen ähnelt aber den Schnappschüssen späterer Fotografien. Nach Zufälligkeit, wie ein eingefangener Augenblick – so wirken die (selbstverständlich auch hier) sehr bewusst gestellten Bilder wie dieses von Frau H. Maria Süßmilch.

Zwischen Fotografie und Malerei
Caspar Heinrich Sonnekes (1821-1899) stammte aus Emden und unterrichtete 40 Jahre lang Kunst am Mariengymnasium in Jever. Als zusätzliche Verdienstmöglichkeit erschloss er sich die Porträtmalerei. Hinzu kam die professionelle Retusche von Fotografien, womit das Fotoatelier in der Neuenstraße werben konnte.
Sonnekes ist also ein echter Grenzgänger zwischen alten und neuen Techniken der Abbildung.

Muse statt Auftragswerk
Arthur Eden-Sillenstede (1899-1977) ⥅ kommt gebürtig aus Sillenstede. Als Malermeister verdiente er sein Geld; die Gemäldekunst jedoch war seine Leidenschaft. Man sah ihn häufig mit Staffelei, Pinseln und Farben im und um das Schloss herum. Vor allem die Landschaft des Jeverlandes fing er in seinen Bildern ein. Wenn er Menschen porträtierte, dann meist aus eigenem Antrieb, weil etwas an seinem Modell ihn interessierte. Den Lebensunterhalt mit Porträtmalerei zu verdienen, wäre aussichtslos gewesen. Das hatte die Fotografie endgültig abgelöst. Dafür hatte der Maler alle Freiheit in Stil und Wahl des Gegenstands. Sein Anspruch musste es nicht mehr sein, ein möglichst genaues Abbild hervorzubringen und einen Auftraggeber zufrieden zu stellen.
Charlotte Clara Hinrichs beispielsweise sehen wir ihr Alter – sie hatte ihren 101. Geburtstag gefeiert – ungeschönt an. Um die Jahrhundertwende hatte sie eine Gastwirtschaft geführt. Auch die dafür notwendige Energie der unverheiratet gebliebenen Frau lässt sich erkennen.

Diese wenigen hier ausgewählten Frauenporträts (und ihre Maler) zeigen viele der Entwicklungen rund um die Porträtkunst bis ins 20. Jahrhundert auf.